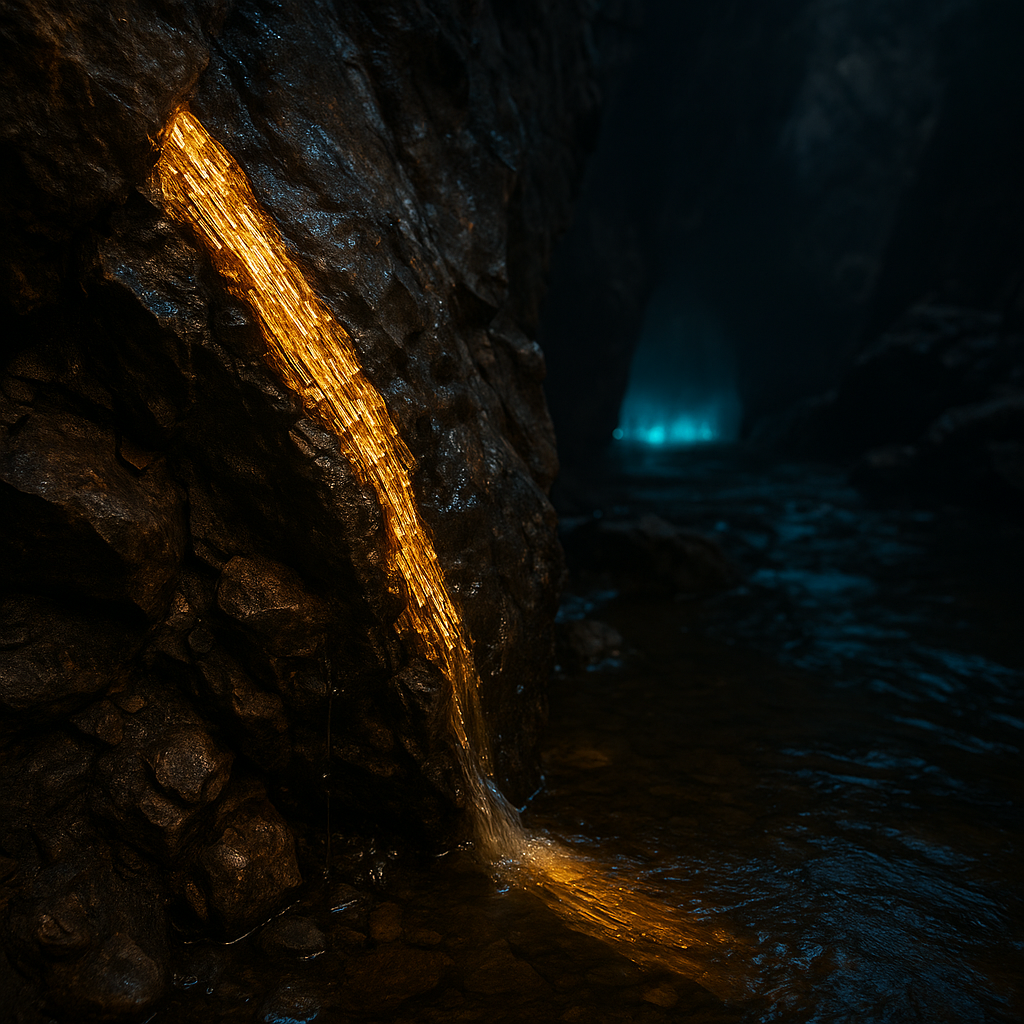Typ: Kristallines Mineral
Erscheinung: Bernsteinfarben, bestehend aus mikroskopisch dünnen, parallelen Röhrchenstrukturen – wie ein dichter Bund aus feinen Strohhalmen
Dichte: 1.2 g/cm³
Herkunft: Ausschließlich in den Wahnwaben zu finden
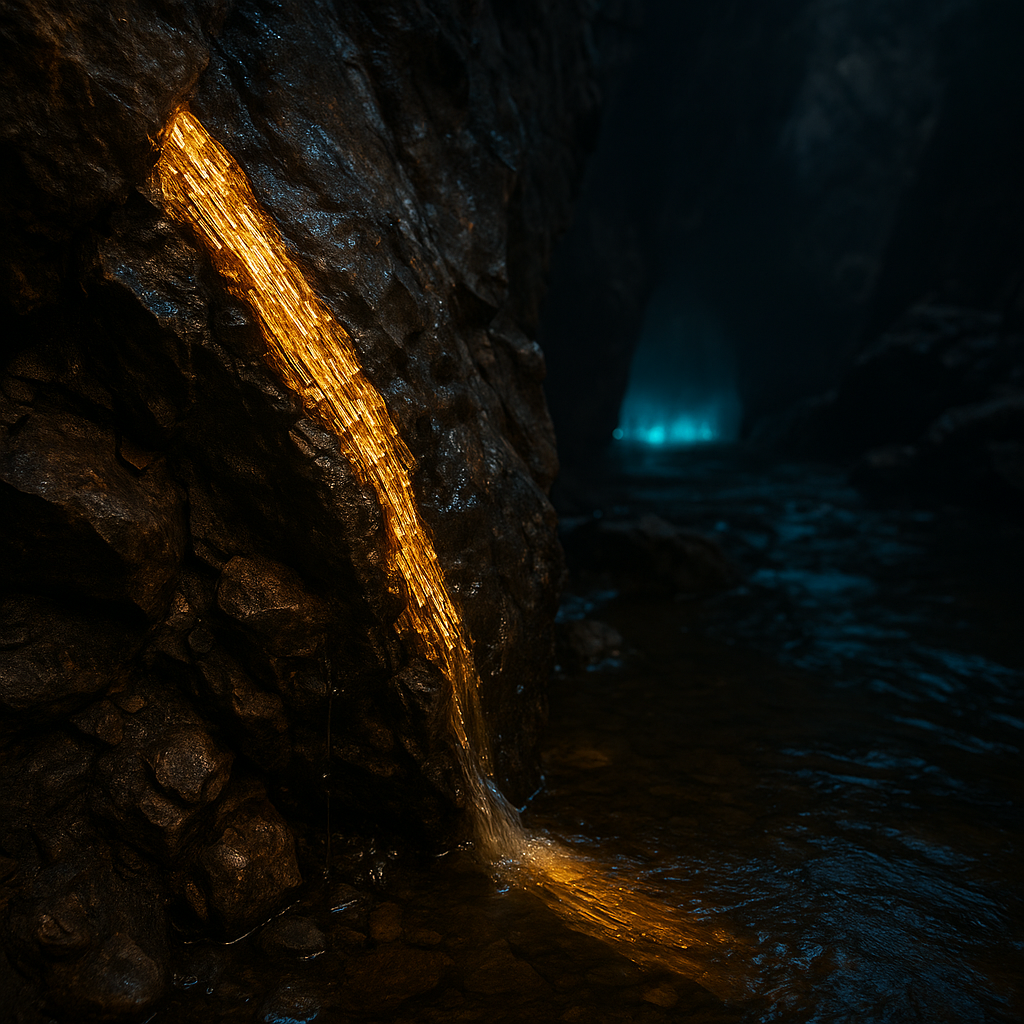
Reaktivität
Piezo-Optolumineszenz
Solanith reagiert auf mechanische Stimulation – insbesondere Druck- und Scherkräfte – mit der spontanen Emission von Licht. Dieser Effekt entsteht durch den inneren Aufbau des Materials: Die hohlröhrenartige Struktur wirkt wie ein Lichtleiter und begünstigt die Umwandlung mechanischer Spannung in photonenbasierte Entladung entlang axialer Defekte.
Strömungsaktivierung
Fließende Gewässer, die über Solanithbetten strömen, erzeugen durch Mikrovibrationen und Impulsübertragungen ein flächendeckendes, wellenartiges Aufleuchten. Dieses Phänomen tritt vor allem bei nährstoffreichen Strömen im Biotopkern der Wahnwaben auf.
Verwendung
Verteidigung
Solanith gilt in der Forschung als vielversprechend für defensive Anwendungen. Seine Fähigkeit, bei mechanischer Einwirkung spontan zu leuchten, kann genutzt werden, um Angreifer zu blenden oder kurzzeitig zu desorientieren – etwa durch taktische Schlagstäbe oder Auslösekristalle. Aufgrund der extremen Seltenheit des Materials findet es bislang jedoch keine kommerzielle Verbreitung.
Info
Beschreibung
Solanith ist ein seltenes Mineral aus den Wahnwaben, das sich durch seine innere Röhrchenstruktur und sein ungewöhnliches Reaktionsverhalten auf kinetische Einflüsse auszeichnet. Die bernsteinfarbene Erscheinung täuscht über seine technische Komplexität hinweg.
Geometrie und Materialstruktur
Die innere Organisation besteht aus eng gepackten Mikrotubuli, die entlang wachstumsabhängiger Richtungen entstehen. Diese Röhren fungieren als Wellenleiter, die sowohl Schall als auch Licht kanalisieren können. Der Aufbau begünstigt gezielte Resonanzkaskaden unter äußeren Impulsen.
Abbaubeschränkung
Da Solanith ausschließlich in aktiven Ökozonen der Wahnwaben auftritt, ist ein großflächiger Abbau nicht möglich. Selbst kleine Entnahmen destabilisieren lokale Mikrozyklen. Bisher wurden nur Proben unter Laborbedingungen untersucht.